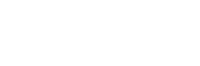Venezuelas Ölindustrie bekommt wieder Anschluss an den Weltmarkt
Die Regierung des Landes hat der Opposition saubere Wahlen für 2024 zugesagt. Dafür wollen die USA schrittweise ihre Sanktionen lockern. Ob sich Präsident Maduro an die Abmachungen halten wird, ist ungewiss.
von Alexander Busch, Lateinamerika-Korrespondent für Handelsblatt und NZZ
Endlich mal eine gute Nachricht aus Venezuela: Das Finanzministerium der USA teilt am Donnerstag mit, dass der bislang verbotene Handel mit Öl des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA ab sofort wieder erlaubt ist.
Ausländische Konzerne dürfen in Venezuelas Ölbranche als Zulieferer für den Staatskonzern auftreten, ohne ihrerseits Sanktionen der US-Behörden befürchten zu müssen. Auch Finanztransaktionen, etwa der Handel von venezolanischen Staatsbonds, sind erlaubt oder die Versicherung von Tankern, die venezolanisches Öl geladen haben. Auch der Handel mit venezolanischem Gold ist ab sofort zulässig.
Diese Genehmigungen sollen im ersten Schritt vorerst bis Mitte April 2024 gelten. Damit weicht die US-Administration erstmals die seit vier Jahre bestehenden Sanktionen gegen Venezuela auf. 2019 hatte der US-Präsident Donald Trump harte Sanktionen gegen Venezuela verhängt, weil das Regime von Nicolás Maduro zuvor offensichtlich die Wahlen gefälscht hatte.
Doch nun hat die Regierung in Caracas nach mehreren geheimen Verhandlungsrunden mit den USA zugesagt, im zweiten Halbjahr 2024 saubere Wahlen abhalten zu wollen. Dazu verpflichtete sie sich in einer gemeinsamen Erklärung, welche die Opposition und Regierungsvertreter am Dienstag dieser Woche in Barbados unterzeichneten.
Die Regierung will ausländische Wahlbeobachter zulassen. Ob sie die Kandidaten der Opposition tatsächlich an den Wahlen teilnehmen lässt, bleibt abzuwarten. Den wichtigsten Führern der Opposition hat die Justiz das passive Wahlrecht entzogen. Die US-Regierung hat klargemacht, dass sie bis November Fortschritte bei der Zulassung der oppositionellen Kandidaten erwarte. Die Sanktionserleichterungen können jeder Zeit wieder aufgehoben werden.
Hintergrund der Annäherung zwischen den USA und Venezuela sind die hohen Ölpreise. Die USA wollen aus strategischen Gründen, dass das Land mit den weltweit größten Öl- und Gasreserven wieder den Weltmarkt beliefert. Das wird nur langsam möglich sein, weil in Venezuela seit vielen Jahren nicht mehr in die Ölindustrie investiert wurde. 200.000 Fass am Tag könnte Venezuela bald zusätzlich exportieren.
Das Abkommen ist für alle Seiten von Vorteil: Venezuelas Wirtschaft werden die aufgehobenen Sanktionen einen Wachstums- und Investitionsschub bringen. Erstmals können private Unternehmen wieder legal im Karibikland investieren.
Das ist auch für deutsche Unternehmen interessant, die traditionell stark in Venezuela waren, sich aber in den letzten Jahre wegen der schweren Krise des Landes zurückgezogen hatten.
Die Regierung wiederum wird Öl ohne den üblichen Abschlag verkaufen können. Bisher verlangen Kunden wie China oder Indien einen Discount auf venezolanisches Öl von bis zu 40 Prozent auf den Weltmarktpreis. Trader und Importeure lassen sich so das Risiko kompensieren, ins Fadenkreuz der US-Justiz zu gelangen.
Die Opposition schließlich hätte die Chance auf faire Wahlen, die ihr in den zehn Jahren, die Maduro nun an der Macht ist, weitgehend vorenthalten wurden. Es bleibt zu hoffen, dass die Sanktionslockerungen neben einer wirtschaftlichen auch eine politische Eigendynamik anstoßen können.
Denn bisher hat Maduro noch nie wirklich Bereitschaft gezeigt, auf die Opposition zuzugehen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Autokrat freie Wahlen mit fairen Startchancen für alle erlaubt, wenn die Gefahr besteht, dass er abgewählt würde.
Ob das Regime bereit ist, der Opposition tatsächlich mehr Handlungsspielraum zuzugestehen, wird man am kommenden Sonntag beobachten können. Letztere hat zu landesweiten Vorwahlen aufgerufen. Die Regierung hatte zuvor das Wahlgericht durch einen taktischen Rückzug seiner Richter wegen des fehlenden Quorums ausgeschaltet.
Die Opposition steht vor der logistischen Herausforderung, in einem Land von der Größe Frankreichs und Deutschlands zusammen Vorwahlen zu organisieren, ohne öffentliche Gebäude benutzen oder sonst mit staatlicher Unterstützung rechnen zu können. Angesichts der ständigen Einschüchterungen und Drohungen durch die Sicherheitskräfte braucht es für die Teilnahme am Wahlakt eine große Portion an persönlichem Mut.