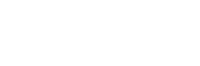Ist der Wahlausgang in Chile der Beginn eines Rechtsrucks in Lateinamerika?
In Chile hat die politische Rechte jetzt die totale Kontrolle bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung. Dabei wurde der linke Präsident Gabriel Boric erst vor einem Jahr mit einer linken Mehrheit gewählt. Ein ähnlicher Pendelschwung nach rechts könnte sich bald in Argentinien und mittelfristig in Brasilien oder Kolumbien wiederholen.
von Alexander Busch, Lateinamerika-Korrespondent für Handelsblatt und NZZ
In eineinhalb Jahren hat sich in Chile die politische Stimmung völlig gedreht. Noch im Dezember 2021 wählte eine Mehrheit den ehemaligen Studentenführer Gabriel Boric mit seiner linken Regierungskoalition.
Jetzt haben die Chilenen bei den Wahlen zum Verfassungsrat mehrheitlich rechts-konservativ gestimmt. Die Republikanische Partei um den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten José Antonio Kast erlebte einen Erdrutschsieg. Gemeinsam mit der traditionellen Rechte haben sie nun eine qualifizierte Mehrheit im Rat. Der soll bis November die neue Verfassung ausarbeiten. Borics Links-Mitte-Koalition schnitt so schlecht ab, dass sie in dem Organ nicht mal eine Vetomacht hat.
Dadurch ist die paradoxe Situation entstanden, dass eine rechte Partei, die nie eine neue Verfassung wollte, die Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes kontrollieren wird.
Der Grund für den Wandel im Abstimmungsverhalten Chiles lässt sich mit dem schwachen Abschneiden der Regierung Boric erklären. Zwei Drittel der Menschen in Chile lehnen seine Mitte-Links-Regierung ab. Die Bevölkerung ist besorgt angesichts der hohen Kriminalität, der Rezession und hohen Inflation sowie der Immigration. Bei diesen Themen punkten traditionell die rechten Parteien.
Obwohl 2020 noch knapp 80 Prozent der Chilenen eine neue Verfassung wollten, ist ihnen das inzwischen nicht mehr so wichtig. Sie haben andere existenziellere Probleme. Zudem macht sich in Chile eine Abstimmungsmüdigkeit breit: Sieben Mal sind die 15 Mio. Wählerinnen und Wähler seitdem zu den Urnen gerufen worden.
Spannend wird nun, ob Kast und seine Partei die Chance nutzen und tatsächlich eine neue Vorlage ausarbeiten werden. Die Mehrheit der Chilenen will, dass mehr sozialdemokratische Elemente in die existierende Verfassung integriert werden. Gut möglich ist aber auch, dass Kast und seine politischen Mitstreiter auf Konfrontationskurs gehen. Sie könnten versuchen, rechtskonservative Forderungen wie der nach einem allgemeinen Abtreibungsverbot zu Verfassungsgesetzen zu machen.
Dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei der nächsten Abstimmung im Dezember auch diese Vorlage abgelehnt würde – wie die vorherige linke Version im September 2022. Ein Ablehnung würde Kasts künftige politischen Chancen verringern.
Die Investmentbanken haben mehrheitlich das Abstimmungsergebnis in Chile begrüßt. Sie hoffen nun, dass sich die allgemeine Unsicherheit über die künftige Verfassung und den wirtschaftlichen Kurs der Regierung Boric reduzieren wird und die Investoren wieder Vertrauen in das Andenland bekommen. Dennoch werden die politische Spannungen anhalten.
Gut möglich ist jedoch, dass sich dieser Rechtsruck kurz- bis mittelfristig auch in anderen Ländern der Region wiederholen könnte. Also überall dort, wo die regierenden linken Regierungen wenig erfolgreich dabei sind, auf die Sorgen und Nöte der Bürger einzugehen.
So etwa in Argentinien, wo im Oktober wahrscheinlich eine konservative Regierung gewählt wird – nach der politisch schwachen Amtszeit des Peronisten Alberto Fernández. Aber auch Gustavo Petro in Kolumbien und selbst Luiz Inácio Lula da Silva zeigen schon zu Beginn ihrer Amtszeit deutliche Schwächezeichen.